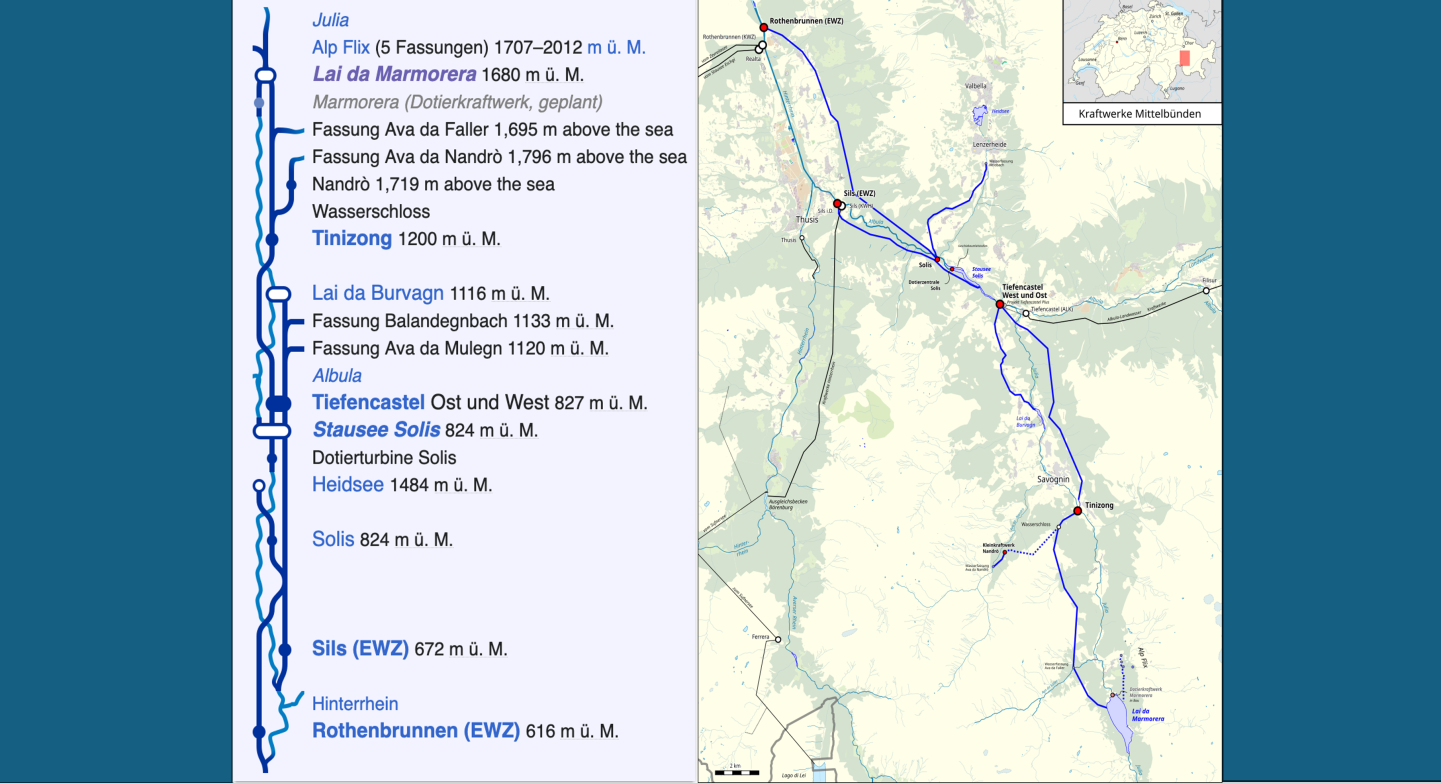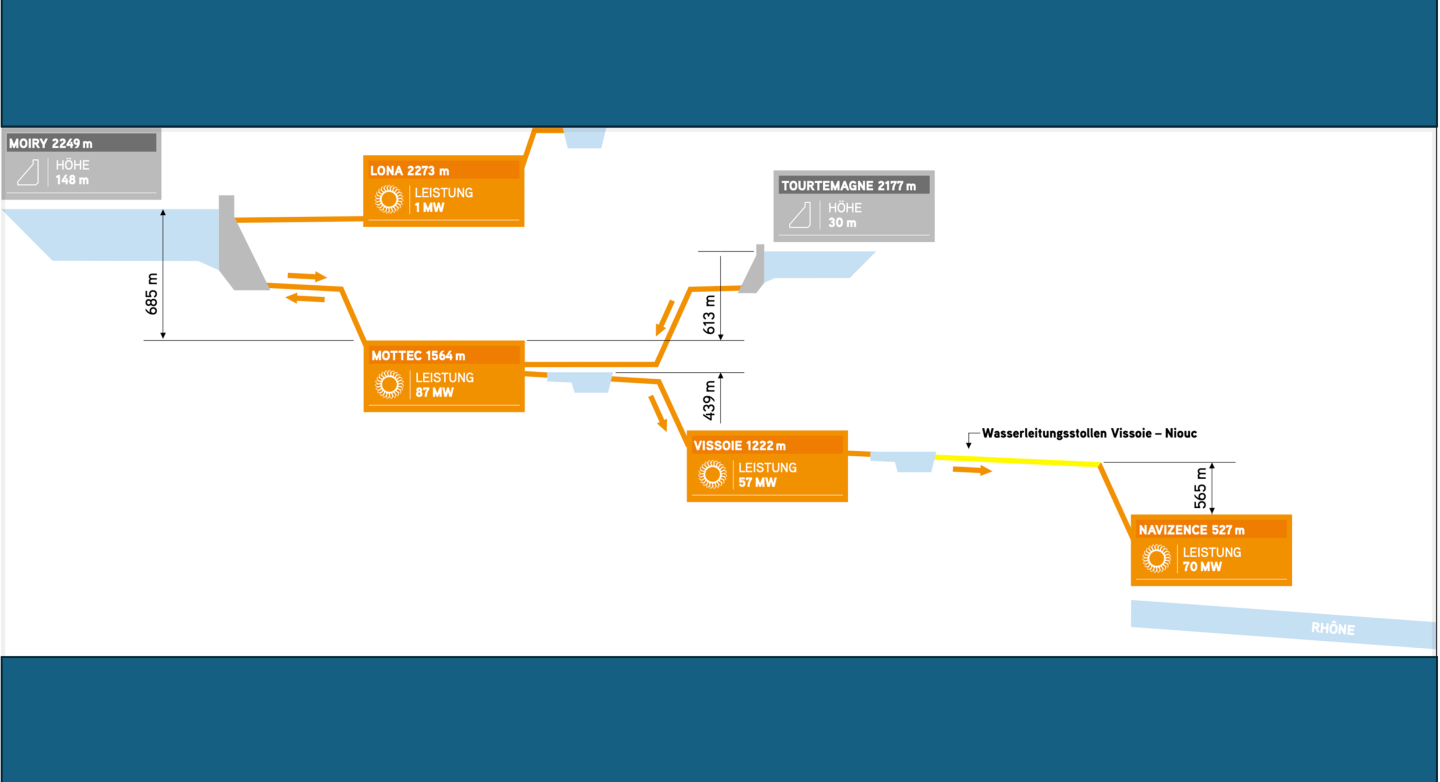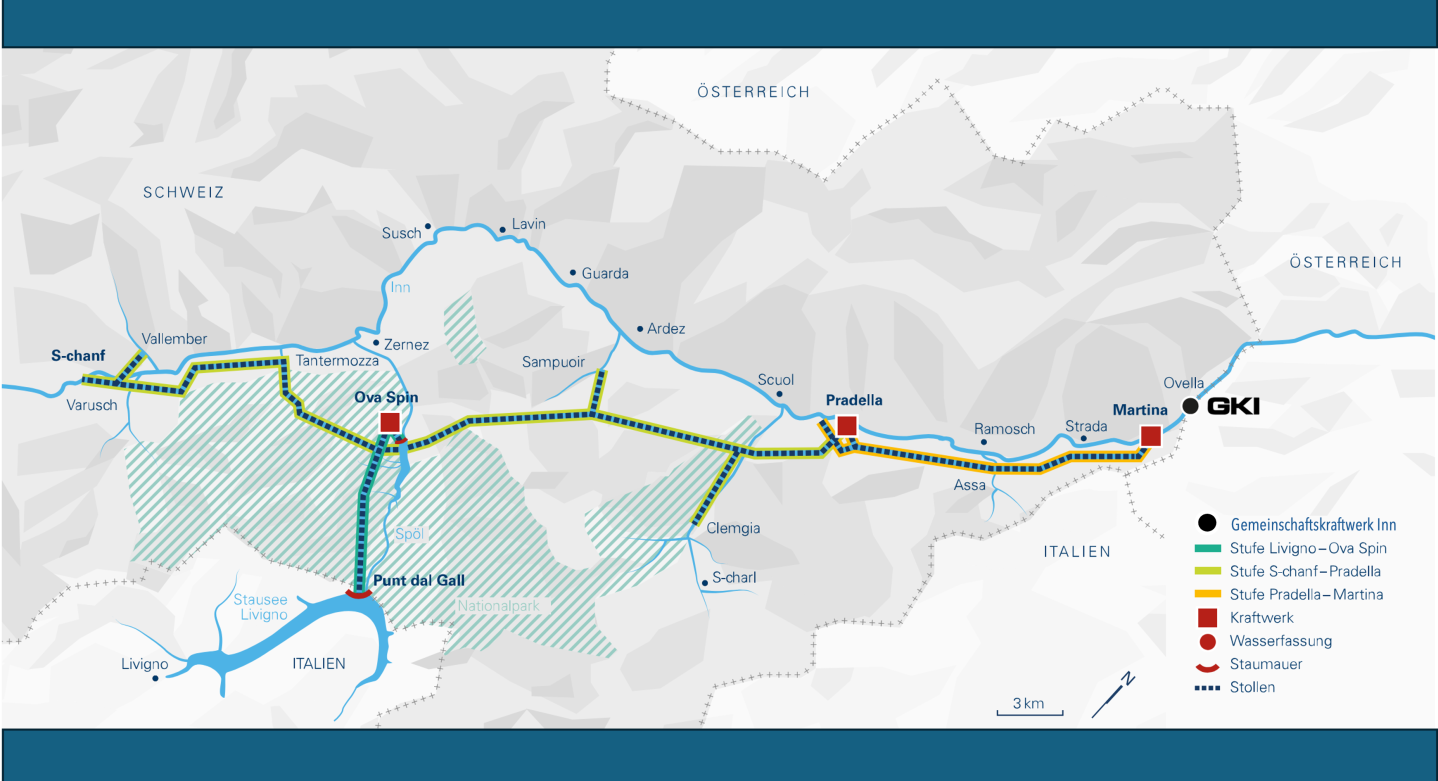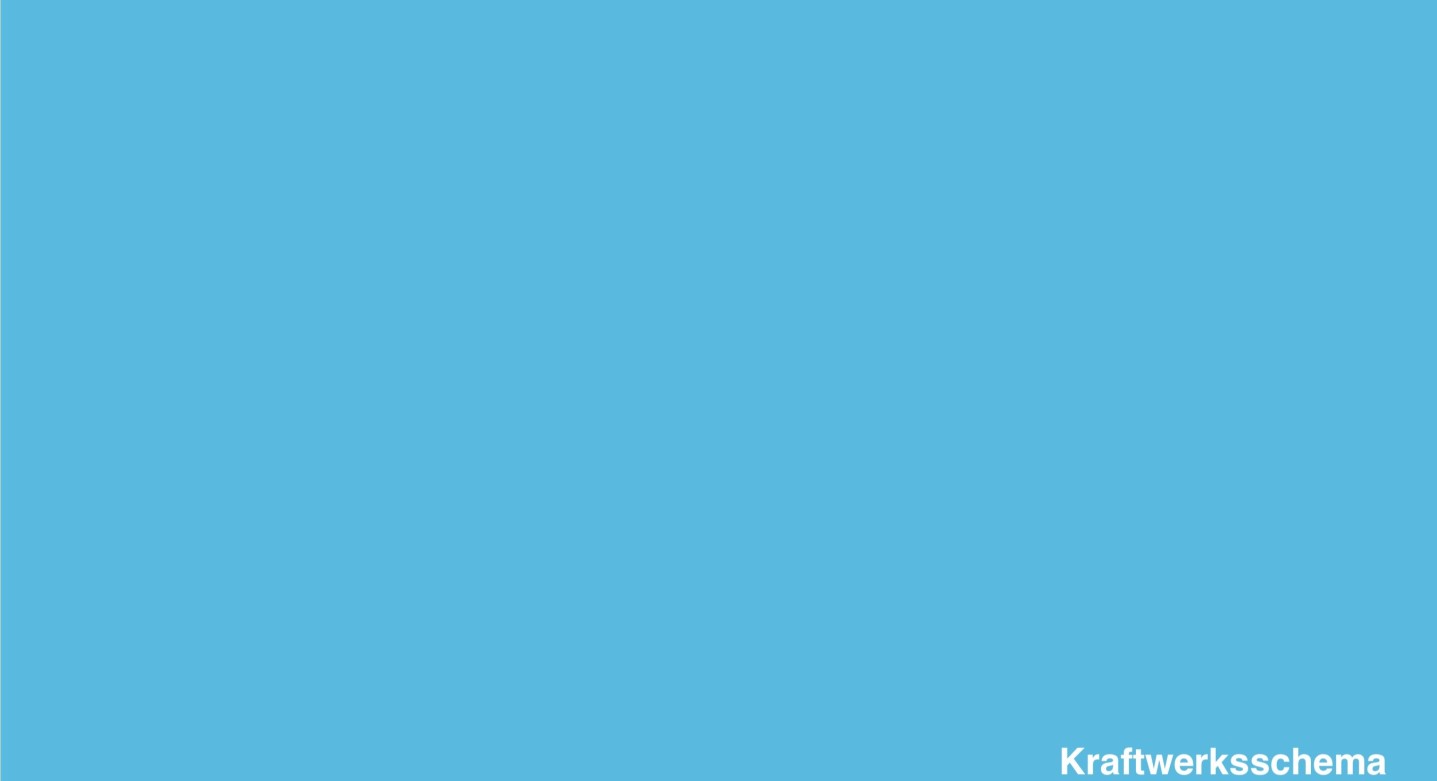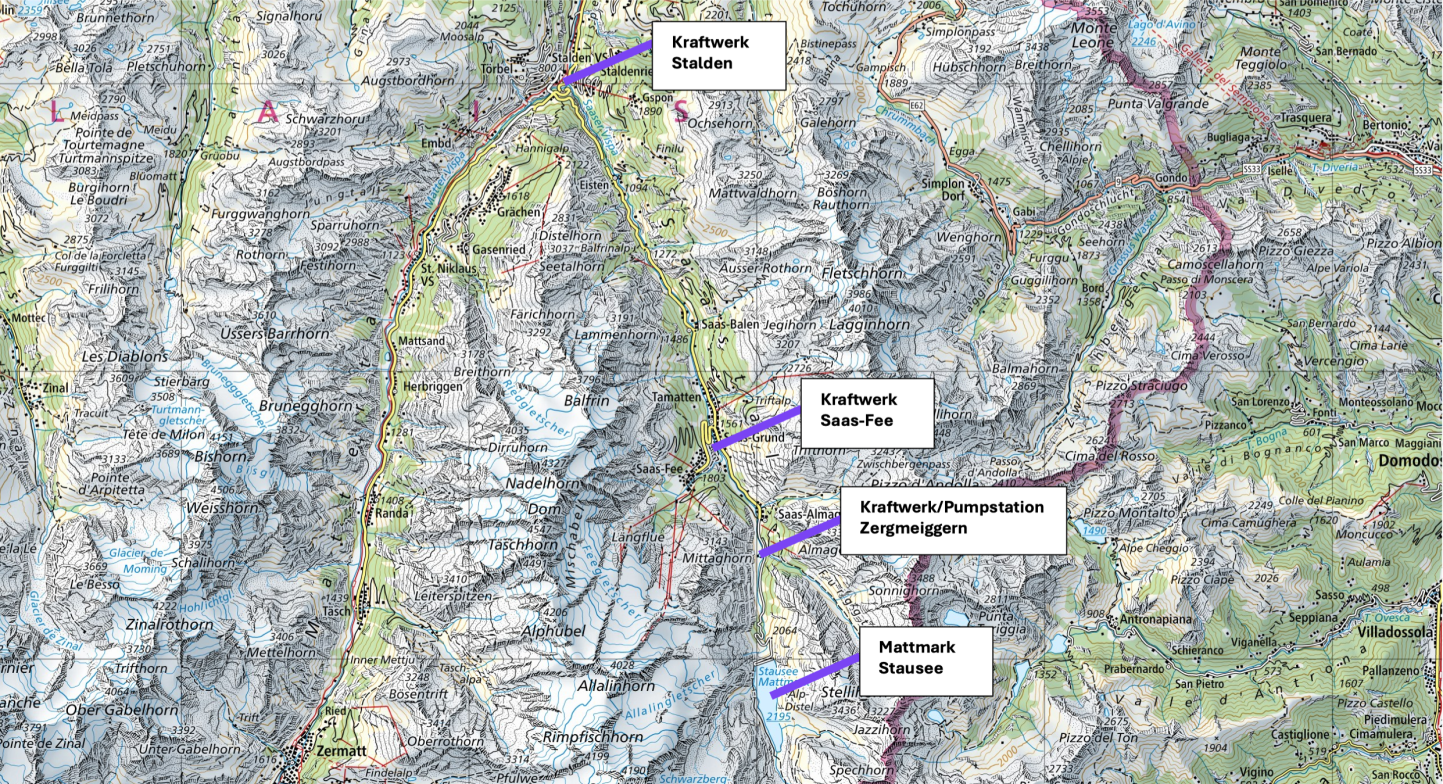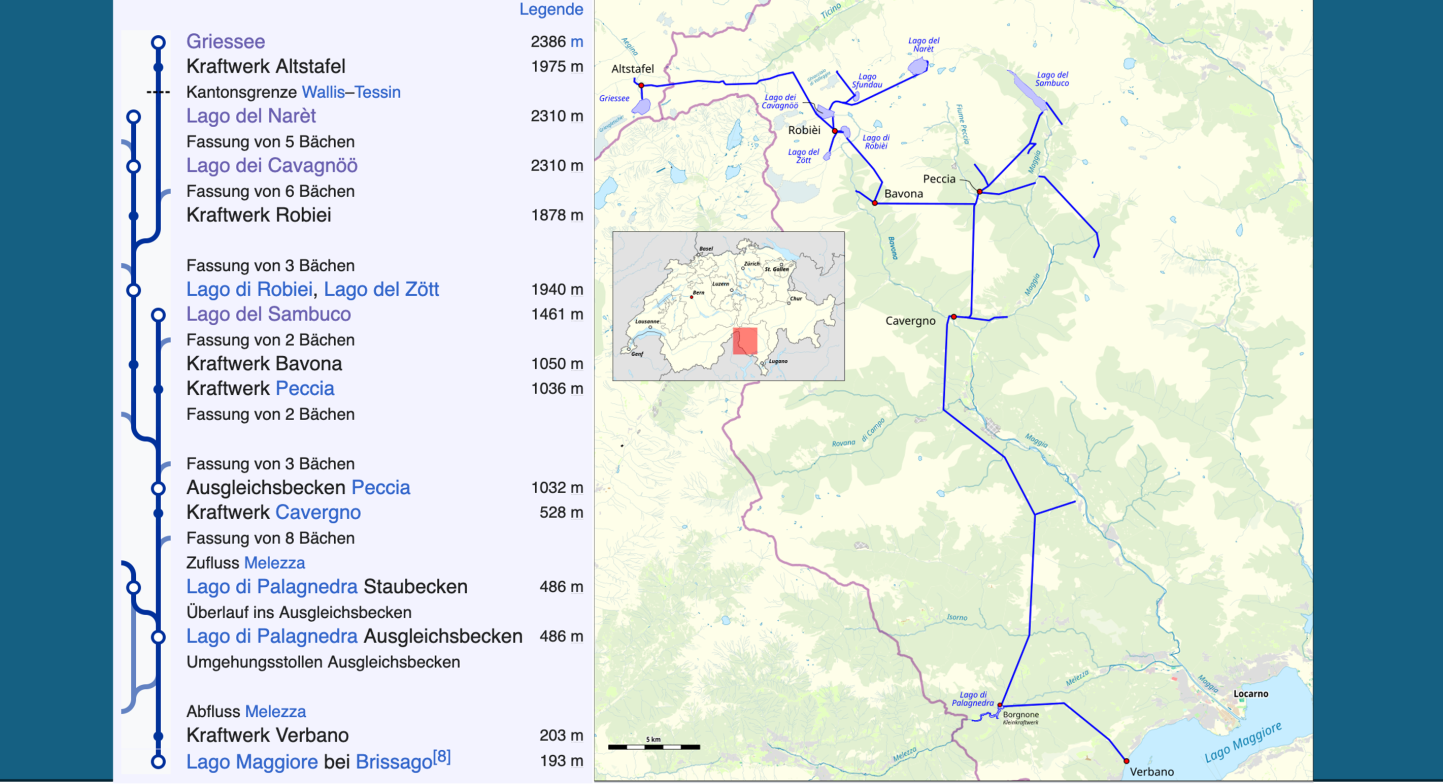Grösster Stausee: Grande Dixence VS
1934 entstand die erste Dixence-Mauer mit einer Höhe von 85 Metern. 1961 wurde sie durch die heutige, 285 Meter hohe Staumauer ersetzt. Sie ist heute die zehntgrösste Talsperre der Welt und nach wie vor das höchste Bauwerk der Schweiz.
Karte
Volumen: 400 Mio. m³
Oberfläche bei vollem Wasserstand: 208 ha
Leistung: 2070 MW
Produktion der Kraftwerksgruppe: 2000 GWh/Jahr
Bauzeit: 1951–1961
Ältester Stausee: Pérolles-Staumauer FR
Der Bau der Mauer wurde 1872 abgeschlossen. Damit handelt es sich um die älteste betonierte Staumauer Europas. Mit der Zeit ist der Stausee stark verlandet, so dass sich kleinere Inseln gebildet haben. Heute ist er ein bedeutendes Natur- und Vogelschutzgebiet.
Karte
Volumen: 0,4 Mio. m³
Oberfläche bei vollem Wasserstand: 35 ha
Leistung: 17,8 GW
Produktion der Kraftwerksgruppe: 52 GWh/Jahr
Bauzeit: 1870–1872
Neuste Staumauer: Muttsee GL
Der 1963 erbaute Erddamm wurde 2015 durch eine Betonmauer ersetzt. Mit 1054 Metern handelt es sich um die längste Staumauer der Schweiz. Auf 2473 Metern über Meer gelegen, ist der Muttsee nach dem Speichersee Viderjoch zudem der am zweithöchsten gelegene Stausee der Schweiz.
Karte
Volumen: 23 Mio. m³
Oberfläche bei vollem Wasserstand: 84 ha
Leistung: 1480 MW
Produktion der Kraftwerksgruppe: 1900 GWh/Jahr
Bauzeit: 2012–2015